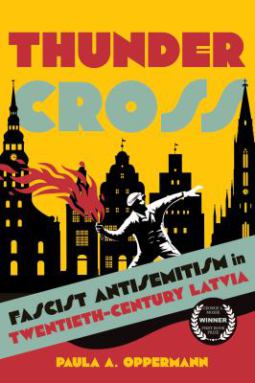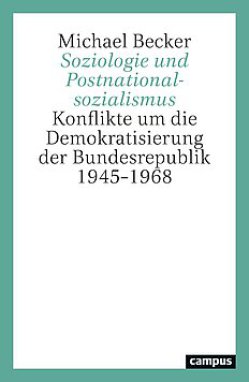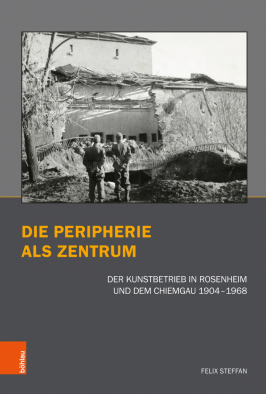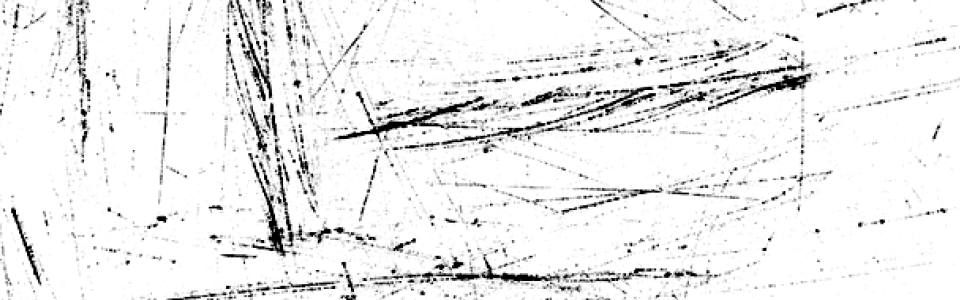
Aktuell schreiben wir den Allgemeinen Förderbetrag aus - Bewerbungsfrist ist der
03. Mai 2026
Informationen zu Bewerbungsvoraussetzungen und
den erforderlichen Unterlagen.
Wir freuen uns, dass wir folgende Publikationen unterstützen konnten:
Oppermann, Paula A., "Thunder Cross. Fascist Antisemitism in twentieth-century Latvia."
University of Wisconsin Press 2025
Founded in 1932, Thunder Cross (Perkonkrusts) was the largest and most prominent right-wing political party in Latvia in the early twentieth century. Its motto - "Latvia for Latvians!" - echoed the ultranationalist rhetoric of similar movements throughout Europe at the time. Unlike the Nazis in Germany or the Fascists in Italy, however, Thunder Cross never succeeded in seizing power. Nevertheless, Holocaust historian Paula A. Oppermann argues, its movement left an indelible mark on the country. The antisemitism at the core of Thunder Cross's ideology remained a driving force for Latvian fascists throughout the twentieth century, persisting despite shifting historical and political contexts. Thunder Cross is the most comprehensive study of Latvia's fascist movement in English to date, and the only work that investigates the often neglected continuities of fascist antisemitism after World War II. Formulated as an empirical case study, this book draws on international and interdisciplinary secondary literature and sources in seven languages to broaden our understanding of fascism, antisemitism, and mass violence from Germany and Italy to the larger European context.
(Text: University of Wisconsin Press)
Becker, Michael, "Soziologie und Postnationalsozialismus. Konflikte um die Demokratisierung der Bundesrepublik 1945-1968"
Campus 2025
Michael Becker analysiert das Verhältnis der Westdeutschen Soziologie zum Nationalsozialismus zwischen 1945 und 1968 und widerlegt die verbreitete Annahme, dass der Nationalsozialismus aus der Soziologie verdrängt wurde. Vielmehr kann die bundesrepublikanische Soziologie als postnationalsozialistische Disziplin verstanden werden: Sie war in ihrer institutionellen Entwicklung, ihren Konfliktlinien und ihren Themenstellungen maßgeblich durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sowie dessen Folgen und Wirkungen in der Gegenwart geprägt. In den Augen ihrer wichtigsten Nachkriegsvertreter war die Soziologie ein intellektuelles Unternehmen zur Demokratisierung der Bundesrepublik. Die Untersuchung verknüpft soziologische und gesellschaftsgeschichtliche Perspektiven und verdeutlicht, wie die Soziologie zur politischen Kultur der Bundesrepublik beigetragen hat. Somit liefert sie auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Nationalsozialismus.
(Text: Campus Verlag)
Steffan, Felix, "Die Peripherie als Zentrum. Der Kunstbetrieb in Rosenheim und dem Chiemgau 1904-1968"
Böhlau 2025
Wie gestaltete sich der Kunstbetrieb in der Provinz im Nationalsozialismus? Dieser Frage geht Felix Steffan in seiner Studie zu Rosenheim und dem Chiemgau nach. Im Zentrum der Untersuchung steht das engmaschige Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren, die das Kunstleben der Provinz maßgeblich beeinflussten und formten. Auf der Grundlage umfangreicher Quellen-analysen wird ersichtlich, wie die Region in nur wenigen Dekaden zu einem bedeutenden künstlerischen Zentrum in der Peripherie der Kunstmetropole München avancierte und diesen Status auch nach 1945 aufrechterhalten konnte.
(Text: Böhlau Verlag)
Gregor, Florian, "Franz Stangl (1908-1971): Leben - Biografische Erzählung - Rezeption. Annäherungen an einen NS-Täter"
Metropol Verlag 2025
Franz Stangl musste sich als einziger ehemaliger Kommandant eines NS-Vernichtungslagers in Deutschland vor Gericht verantworten, nachdem Brasilien ihn 1967 an die Bundesrepublik ausgeliefert hatte. Vom Beamten im "Judenreferat" der Staatspolizei-leitstelle Linz (1938-40) und stellvertretenden Büroleiter der Tötungsanstalt Hartheim (1940/41) stieg er bis zum Kommandanten der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka (1942/43) und schließlich Leiter von zwei Einsatzstäben in der Operationszone Adriatisches Küstenland (1943/44) auf, deren Auftrag in der Partisanenbekämpfung und Judenverfolgung bestand. 1970 verurteilte das Landgericht Düsseldorf Stangl zu lebenslanger Haft. Er starb, bevor das Urteil rechts-kräftig wurde. Vor Gericht und in Gesprächen mit der Journalistin Gitta Sereny hatte Stangl eine biografische Erzählung präsentieren können, die sich schließlich in Wissenschaft und Öffentlichkeit etablierte. Florian Gregor untersucht, wie es Stangl gelang, seine Deutung der nationalsozialistischen Vergangenheit zu verbreiten, und betont die Relevanz kulturhistorischer und institutioneller Ansätze für die NS-, Holocaust- und Täterforschung.
(Text: Metropol Verlag)
Zeitlehren
Zeitlehren möchte durch die Förderung von wissen-schaftlichen Projekten in verschiedenen Fachbereichen der NS-, Antisemitismus- oder Holocaustforschung einen Beitrag zum Austausch über Fragen der Entstehung und Ausprägungen antidemokratischer und menschenverachtender Ideologien leisten. Neben einem Bewusststein für die Wurzeln und Auswirkungen insbesondere des deutschen Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert soll dabei auch unser heutiges Verständnis von Demokratie, Gleichberechtigung und kultureller Teilhabe in den Fokus gerückt werden. Zeitlehren verfolgt diese Ziele durch eigene Fördermaßnahmen und durch die Unterstützung von jungen Wissenschaftler* innen.
Hieraus ist - als ein wesentlicher Bestandteil der Stiftungsarbeit - ein Netzwerk von sogenannten Nachwuchswissenschaftler*innen entstanden, das dem hierarchiefreien, interdisziplinären fachlichen Austausch dient, aber auch Raum für gemeinsame Projekte, gegenseitige Anerkennung und für Gespräche über die Herausforderungen der Promotions- und Forschungssituation bietet.
Kooperationen und Spenden
Hier finden Sie eine Liste der von der Stiftung Zeitlehren geförderten Nachwuchswissenschaftler*innen.